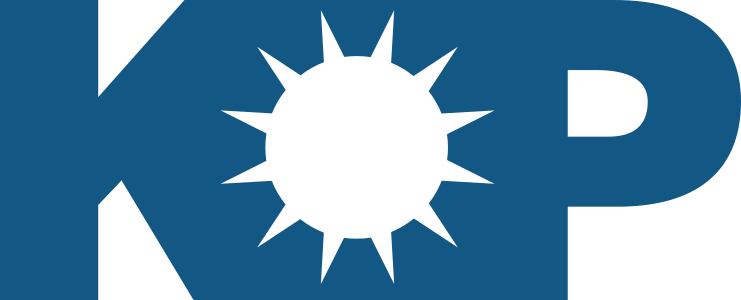Von Sebastian Friedrich und Johanna Mohrfeldt1
[Der Artikel erschien im Juli 2012 in ZAG – Antirassistische Zeitschrift Nr. 61, http://www.zag-berlin.de/antirassismus/archiv/inhalt61.html]
Ende Februar urteilte das Verwaltungsgericht Koblenz, dass Beamte der Bundespolizei auf Bahnstrecken, „die Ausländern zur unerlaubten Einreise oder zu Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz dienen, verdachtsunabhängig kontrollieren“ und die Auswahl der Anzusprechenden „auch nach dem äußeren Erscheinungsbild“ getroffen werden darf.2 Auch wenn das Urteil in der nächsten Instanz gekippt wird, erweitert die Legitimation eines Gerichts die Möglichkeit einer Verlagerung der Diskussionen um die Thematik; weg von einer Kritik an solcherlei Polizeipraxen hin zu einer Debatte zur „notwendigen“ Anwendung. Dies spätestens dann, wenn ein Ereignis wie ein terroristischer Anschlag entsprechend von einigen Medien und Politiker_innen hochgekocht wird.
Dennoch konnte dieses Urteil kaum überraschen, ist doch die in der Begründung quasi-legitimierte Praxis des „Racial Profiling“ schon lange Teil der alltäglichen Polizeiarbeit. Wir begreifen „Racial Profiling“ als Symptom des Institutionellen Rassismus der Polizei. Der Begriff des Institutionellen Rassismus ist umstritten und wird zuweilen inflationär verwendet. Daher lohnt im ersten Schritt eine kurze Begriffsbestimmung. Anschließend wird dargestellt, wie Institutioneller Rassismus und „Racial Profiling“ in die Polizeipraxis eingeschrieben sind. Schließlich werden wir anhand unserer Erfahrung aus der Arbeit für die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) mögliche Interventionen gegen die alltägliche rassistische Polizeipraxis vorstellen.
Institutioneller Rassismus der Polizei
Wir verstehen Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis, bei dem Gruppen von Menschen zu einer „Rasse“, einer „Ethnie“ und/oder einer „Kultur“ konstruiert werden, auf deren Grundlage eine Wertung entsprechend den herrschenden Machtverhältnissen aus Perspektive privilegierter Positionen heraus vorgenommen wird. Die konstruierten Gruppen werden als dichotom gegenübergestellt, wobei der unterdrückten Gruppe soziale Eigenschaften als unveränderlich zugeschrieben werden. Rassismus durchdringt unterschiedliche Ebenen (z.B. Alltag, Medien, Wissenschaft, Arbeitsplatz) und kann unterschiedliche Formen annehmen.
Rassismus erscheint keineswegs nur individuell, sondern kann überhaupt nur als Teil gesellschaftlicher Strukturen begriffen werden. Von Institutionellem Rassismus kann geredet werden, wenn er in Institutionen eingeschrieben ist, d.h. sich in den entsprechenden Praxen und Anordnungen systematisch organisiert. Dabei ist es unerheblich, inwiefern Akteur_innen innerhalb der Institutionen absichtsvoll handeln oder nicht, insofern ihre Routinen im Effekt Ungleichheitsverhältnisse stabilisieren und legitimieren.
Bei der Polizei weisen rassistische institutionalisierte Praxen eine große Bandbreite auf. Sie reichen von selektiven Kontrollen, körperlichen, psychischen und sexuellen Misshandlungen bis hin zu Mord. Die Wahrnehmung rassistischer Polizeigewalt in der Öffentlichkeit ist weitgehend gering. Nur wenige Fälle werden von Seiten der Medien und Politik aufgegriffen, wie beispielsweise der Tod von Oury Jalloh, der am 7. Januar 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannte. Die Tötungen von Laya Condé, der am gleichen Tag nach einem Brechmitteleinsatz in Polizeigewahrsam in Bremen verstarb, von Slieman Hamade, der am 28. Februar 2010 bei einem Routineeinsatz durch Pfefferspray in Berlin getötet wurde, oder von Christy Schwundeck, die von einer Polizistin am 19. Mai 2011 in einem Frankfurter Jobcenter erschossen wurde, wären beinahe unerwähnt geblieben. Hier waren es Netzwerke von Freund_innen, Verwandten und/oder Aktivist_innen, die den öffentlichen Druck formierten und die mediale und politische Präsenz erkämpften. Bei der medialen und politischen Aufbereitung dieser und anderer Tötungen wird häufig von Einzelfällen gesprochen, von „traurigen“ Ausnahmen durch individuelle Fehlleistungen einzelner Polizeibeamt_innen. Diese Legende der bedauerlichen Einzelfälle individualisiert rassistische Polizeigewalt.
Dabei handelt es sich keineswegs um Einzelfälle. Die institutionelle Verankerung des Rassismus bei der Polizei drückt sich zwar auch in den genannten Beispielen aus, in denen Menschen durch Polizeieinsätze ums Leben kommen, deutlicher wird sie allerdings bei der Betrachtung alltäglicher rassistischer Polizeipraxen. Rassistische Polizeigewalt ist nicht nur Gewalt institutioneller Art mit Methode, sondern hängt auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen. So ermöglicht etwa die Schleierfahndung Kontrollen im bundesdeutschen Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern, ebenso auf Transitstrecken und in öffentlichen Einrichtungen des internationalen Verkehrs, zum Beispiel auf Bahnhöfen oder Flughäfen. Ein Beispiel auf Länderebene bilden die „anlass- und ereignisunabhängigen“ Personenkontrollen, bei denen die Identität von Personen ohne konkreten Verdacht festgestellt werden darf. Diese dürfen zulässigerweise an „kriminalitätsbelasteten Orten“ – die früher auch als „gefährliche Orte“ bezeichnet wurden3 – durchgeführt werden. Darüber hinaus ist es gesetzlich erlaubt, Personen an Verkehrs- und Versorgungsanlagen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Amtsgebäuden sowie anderen besonders gefährdeten Objekten oder in deren unmittelbarer Nähe und an polizeilich eingerichteten Kontrollstellen „verdachtsunabhängig“ zu kontrollieren.
Racial Profiling
Diese Gesetzesgrundlagen legalisieren die Praxis des „Racial Profiling“. „Racial Profiling” bezeichnet die Erstellung eines Verdächtigenprofils, bei dem rassialisierte Merkmale wie Hautfarbe, Haarfarbe oder religiöse Symbole (in der Regel in Zusammenwirkung mit Faktoren wie Gender, Klasse, Alter) maßgeblich handlungsleitend für polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, Durchsuchungen, Ermittlungen und/oder Überwachung werden. Dabei ist der Begriff eingebunden in Konzepte zu rassistischer Unterdrückung, die historische Konjunkturen rassistischer Einstellungen berücksichtigen, welche als Mechanismen sozialer Ein- und Ausgrenzung fungieren und in gesellschaftlichen Strukturen eingeschrieben sind.
Ein konkretes und dokumentiertes Beispiel für „Racial Profiling“ in der Bundesrepublik Deutschland stellen dabei die Kriterien der „Rasterfahndung“ im Zusammenhang des „Kampf gegen den Terror“ in Folge der 11. Septembers 2001 dar: Anvisiert werden männliche Akademiker technisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge im Alter zwischen 18 und 41 Jahren mit vermutlich islamischer Religionszugehörigkeit, die aus bestimmten „islamischen“ Staaten immigriert und bislang nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind. Deutlich wird die Abwesenheit von konkretem strafrechtsrelevantem Verhalten der verdächtigten Personen, die charakteristisch für die Praxis des „Racial Profiling“ ist. Es werden bestimmte kriminelle Aktivitäten definiert, beispielsweise Terrorismus, und gesellschaftlichen Gruppen zugeordnet, die vorher durch rassialisierte körperliche Attribute markiert worden sind.
Exemplarisch für unzählige, nicht berichtete Erfahrungen mit „Racial Profiling“ steht der Fall von Amare B.*, der irgendwo in Berlin auf irgendeiner Straße zu irgendeinem Zeitpunkt telefoniert. Zufällig bekommen Polizeibeamte in ebenjenem Moment einen Hinweis auf einen Süßigkeitendiebstahl mit unbestimmtem Täterprofil. Die Beamten erblicken Amare B. und sofort ist seine rassialisierte Hautfarbe und das assoziierte Bild des „kriminellen Ausländers“ handlungsleitend. Es geschieht das, was häufig geschieht: keine Befragung, keine Rechtsbelehrung, statt dessen Angriff, Fixierung, Gewaltanwendung, Durchsuchung.
„Offiziell“ gibt es „Racial Profiling“ in der Bundesrepublik Deutschland nicht. In einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung zum Thema ›Bekämpfung von Rassismus bei der Polizei‹ fragten Abgeordnete im Jahr 2008 u.a. nach der Praxis des „Racial Profiling“. Die Antwort der Bundesregierung lautete: „Der Begriff des ‚racial profiling‘ ist aus den USA bekannt. (…) In der Bundesrepublik Deutschland verbietet sich eine solche Vorgehensweise schon auf Grund des Grundgesetzes und des rechtsstaatlichen Systems. Daher bedienen sich weder das Bundeskriminalamt (BKA) noch die Bundespolizei eines solchen Instruments.“ Hier stellt sich die Frage: Verbietet sich das Koblenzer Urteil aufgrund des Grundgesetztes selbst? Oder verbietet sich das rechtstaatliche System, dessen Ausdruck es ist? Die Absurdität der Leugnung ist offenkundig, allerdings nicht erst seit diesem Urteil, denn die Systematik der Praxis lässt sich längst in Berichten von Betroffenen und in ihrer legalen Verankerung nachvollziehen.4
Institutioneller Rassismus legt sich wie ein Netz über Diskurse, Handlungen und Gesetze, die sich wiederum gegenseitig stützen. So handeln Polizist_innen beispielsweise bei „anlass- und ereignisunabhängigen Kontrollen“ nicht nur in Übereinstimmung mit herrschenden Diskursen. Sie lenken den Diskurs auch wesentlich mit, um das Bestehen des Apparats zu rechtfertigen bzw. auszuweiten. Den „Erfolg“, den Beamt_innen im Rahmen solcher Kontrollen oder bei Schleierfahndungen verbuchen, sollen die Gesetze bestätigen und das Handeln der Polizei rechtfertigen.
Die Konstruktion von Erfolgen zeigt sich exemplarisch bei den restriktiven Gesetzen für Flüchtlinge im Asylverfahren oder mit Duldung. Diese Gesetze sind ausschließlich ihnen auferlegt und können somit auch nur von ihnen „gebrochen“ werden. So kann eine Person nur unerlaubt „ihren“ Landkreis verlassen, wenn für ihn_sie die Residenzpflicht gilt. Führt nun die Polizei beispielsweise gezielt auf Bahnhöfen Personenkontrollen durch, können sich derartig „Erfolge“ einstellen, die wiederum die „Effektivität“ des „Racial Profiling“ als Handlungsmaxime bestätigen.
Was tun? Von der Analyse zum gemeinsamen Kampf
Das Wissen über Institutionellen Rassismus und die Praxis des „Racial Profiling“ vermitteln in erster Linie diejenigen, die davon betroffen sind und sich alltäglich zur Wehr setzen. Ihre Erfahrungen, Berichte und Strategien gaben 2003 in Berlin den Anlass für die Gründung der „Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt“ (KOP), die sich im Kampf gegen rassistische Polizeigewalt mit den Betroffenen dieser Polizeipraxis solidarisiert.
KOP hat sich zunächst als Rechtshilfefonds gegründet. Damals konnten Betroffene keine finanzielle Unterstützung in juristischen Verfahren erwarten, wenn sie durch eine Strafanzeige belastet waren. Betroffene rassistischer Polizeipraxis sind aber nahezu ausnahmslos mit Strafanzeigen konfrontiert: weil sie von Polizist_innen angezeigt werden, nachdem sie deren rassistische Praxis beim Namen nennen („Beleidigung“); weil sie deren Gewalt nicht regungslos hinnehmen („Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“); oder weil sie den Mut, die Kraft und die Möglichkeit besitzen, die Demütigungen und Verletzungen zur Anzeige zu bringen („Körperverletzung im Amt“ und „Beleidigung“) und dann mit Gegenanzeigen eingeschüchtert werden, die das polizeiliche Handeln nachträglich legitimieren sollen.
Neben diesen – in ihren Effekten – rassistischen Routinen in Polizei und Justiz wird das Engagement von Betroffenen rassistischer Polizeigewalt erschwert durch weitere institutionelle Hürden: So sind sowohl Polizei und Justiz von Berufs wegen machtvoll Handelnde, mit einer starken Perspektive auf „Kriminalität“, deren Bestimmungen wiederum diskursiv normiert sind. Dies umschließt die Dimensionen des Wissens, Handelns und des Apparats von Polizei und Justiz selbst, die wiederum aufeinander zurückwirken. Setzen sich Betroffene gegen rassistische Polizeigewalt zur Wehr, ist der (normierte) Reflex derjenige der Leugnung (Wissen), die nicht selten in eskalierendes Verhalten wie Beleidigungen, Fixierungen, Schläge und Demütigungen übergeht (Handeln), um dann machtvoll im Rahmen der Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft definiert zu werden (Vergegenständlichung). Aus diesen Verwicklungen resultieren wiederum kriminalisierende mediale Darstellungen, unzureichende (Selbst-)Repräsentation und der daraus folgende psychische Schmerz usw.
In Berlin und Brandenburg ist es Initiativen und Gruppen wie Plataforma, Allmende, dem Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V. oder der Flüchtlingsinitiative Berlin-Brandenburg gelungen, eine Position innerhalb dieser rassistischen Verflechtung einzunehmen. Sie wird behauptet und verteidigt von denjenigen, die rassistische Praxen in Kitas und Schulen, Ausbildung und Arbeit, Behörden und Politik, Gesetzen und Justiz demaskieren und konkret angreifen, weil sie von diesen betroffen sind.
Die Arbeit von KOP ist demgegenüber geprägt durch das Engagement von Aktivist_innen of Color und weißen Aktivist_innen. Für Letztere ist es oft einfacher, privilegierte Zugänge zu erhalten und gehört zu werden. Das ist ebenfalls Teil der rassistischen Realität, in die wir alle – positiv oder negativ – verwickelt sind.
Die Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Aktivist_innen orientiert sich an dem jeweils Notwendigen im konkreten Fall und an einem Verständnis von Widerstand gegen Rassismus, das hieraus hervorgeht. So unterstützt KOP Betroffene in ihren Strategien, organisiert Räume, in denen sie für sich sprechen und kämpfen können, berät, finanziert und begleitet. Außerdem werden die Möglichkeiten genutzt, Betroffenen Podien zu bieten und ihre Perspektiven in Publikationen und auf Veranstaltungen öffentlich zu machen, und Kontakte für die gemeinsame Arbeit und den gemeinsamen Kampf zu politischen Gruppen und Parteien, Initiativen, Menschenrechtsorganisationen und –institutionen herzustellen. Damit hilft KOP, Institutionellen Rassismus sichtbar zu machen und seine Dimensionen und Verstrickungen zu entlarven. Dieses Wissen wirkt zurück auf gelebte Formen der Solidarität.
Das Verständnis von Rassismus in seiner strukturellen, institutionalisierten und individuellen Dimension ist die Voraussetzung, um solidarisch mit den durch ihn Positionierten, Markierten und Kriminalisierten zu kämpfen. Grundlegend für diese Arbeit ist jedoch auch das Bewusstsein, dass auch Unterstützungsstrukturen verwickelt sind in die Logik von Rassismus und auch Aktionsformen dieser routinierten Logik folgen.
Zu den Autor_innen
Die Autor_innen sind aktiv bei KOP Berlin (Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt).
1 Für Anmerkungen, Kritik und Hinweise danken wir unseren Freund_innen von KOP.
2 Verwaltungsgericht Koblenz: Identitätsfeststellung eines Zugreisenden. Pressemitteilung Nr. 11/2012 am 28.2. Online einsehbar unter: http://www.mjv.rlp.de/icc/justiz/nav/613/broker.jsp?uMen=613ee68a-b59c-11d4-a73a-0050045687ab&uCon=8f40ae69-1515-6317-84b1-f84077fe9e30&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
3 Dabei definiert die Polizei anhand konkreter Lage- und Ermittlungserkenntnisse, welcher Ort innerhalb der Bundesländer als „kriminalitätsbelastet“ zu gelten hat. Diese Erkenntnisse sollen der Behörde statistisch aufbereitet vorliegen. Der Öffentlichkeit werden die Daten nicht zugänglich gemacht. Damit ist nicht überprüfbar, inwiefern die Definition einer tatsächlichen Sachlage entspricht.
4 Vgl. die Dokumentation von Betroffenenberichten zwischen 2000 und 2011 (www.kop-berlin.de); zur Beschreibung und Ächtung von „Racial Profiling“: Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 7 (CRI [2007]38, 2002) und Nr. 11 (CRI [2007]39, 2007), Agentur für Grundrechte der Europäischen Union: Für eine effektive Polizeiarbeit. Diskriminierendes „Ethnic Profiling“ erkennen und vermeiden. Ein Handbuch, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010, Luxembourg; zur Einschätzung von Menschen- und Bürgerrechtsakteur_innen beispielhaft: Gössner, Rolf 2007: Menschenrechte in Zeiten des Terrors. Kollateralschäden an der ‚Heimatfront‘, Hamburg; Herrnkind, Martin 2000: Verdacht des Verdachtes. Institutionalisierter Rassismus und weitere Implikationen der Schleierfahndung (http://www.safercity.de/2000/schleierfahndung.html