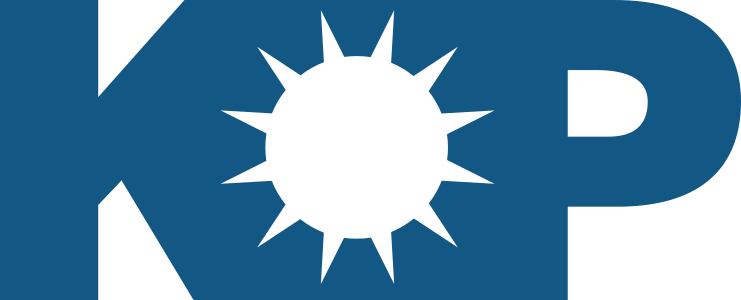*Der Artikel ist in der ZAG, Nr. 67, 2014 erschienen.*
Frances Henry, Anthropologin und Historikerin, forscht seit den 1970er Jahren zum Thema institutioneller Rassismus in Kanada. Im Oktober 2012 folgte die emeritierte Professorin der York University in Toronto einer Einladung der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) und sprach auf der Berliner Konferenz »Racial Profiling Reloaded« über Rassismus im Polizeiapparat und Möglichkeiten der Intervention und Dokumentation. Im Zuge ihres Aufenthalts in Berlin fand dieses Interview mit ihr statt.
Sie haben unter anderem zu Rassismus in den Medien, in der Universität, der Kunst, aber auch zur rassistischen Polizeipraxis des Racial Profiling veröffentlicht. War das Thema »rassistische Polizeikontrollen« bereits auf der antirassistischen Agenda, als Sie anfingen, zu Rassismus zu forschen?
Racial Profiling ist ein sehr junger US-amerikanischer Begriff – früher hieß es einfach Rassismus. Der Begriff beschreibt den spezifischen polizeilichen Gebrauch der Technik des Profiling, um bestimmte Individuen zur Zielgruppe zu machen. Menschen mit kritischen, antirassistischen Positionen wussten von Racial Profiling, weil Menschen in der Schwarzen Community es die ganze Zeit erlebten und davon berichteten. Ich war immer an institutionellem Rassismus interessiert, an der Art, wie rassistische Ideologie und rassistisches Verhalten in Praktiken von Organisationen übersetzt wird und daran, wie dies die
Menschen in den Organisationen und Institutionen beeinflusst. Ich forsche seit langem zu Rassismus in Kanada und ich bin ziemlich sicher, dass eine Studie, die ich 1974 veröffentlichte, die erste Studie zu Rassismus in Kanada überhaupt war. Das von Carol Tator und mir 2006 veröffentlichte Buch »The Colour of Democracy« lieferte den Beweis für Rassismus in allen gesellschaftlichen Institutionen, auch in der kanadischen Justiz und in der Polizei.
Gab es einen besonderen Anlass, sich Racial Profiling wissenschaftlich zu nähern?
Mein Interesse am Thema wurde durch eine Studie des »Toronto Star« geweckt. Diese Zeitung, die für ihren investigativen Journalismus bekannt ist, führte 2002 eine Studie zu Racial Profiling in der Polizei von Toronto durch. In ihrem Bericht wurde Racial Profiling sehr offensichtlich: hinsichtlich der Anzahl der Kontrollen, der Durchsuchungen, der Ingewahrsamnahmen, der Anklagen, der Schwere der Anklagen, der Verurteilungen, der Möglichkeit auf Kaution entlassen zu werden, die Schwarzen Menschen wesentlich seltener gewährt wurde als Weißen. Das führte zu meinem Interesse am Thema und in Folge führten Carol Tator und ich eine eingehendere Studie zu Racial Profiling durch. In »Racial Profiling in Canada« verschoben wir den Fokus hin zu zwei Dingen. Zum einen enthielt die Studie die Geschichten der Betroffenen, die normalerweise als Einzelberichte abgetan werden und die aus Sicht der Justiz einfach eine Serie von Anekdoten darstellen. Kritische Forschung betont hingegen die Notwendigkeit, die Betroffenen sprechen zu lassen. Der andere Schwerpunkt lag auf der Organisationsweise der Polizei, also auf der autoritären militärähnlichen Struktur, und auf der tatsächlichen Anwendung der Technik des Profiling.
Woher kommt das »racial« im Begriff »Racial Profiling«?
Die Polizei muss eine Serie von Arten, Kriminelle oder Verdächtige zu identifizieren, aufstellen. Sie hat immer gesagt, dass Profiling ein wichtiges Werkzeug ist, um Sicherheit zu gewährleisten. Wir waren der Meinung: Ja, aber wenn race oder das äußere Erscheinungsbild ein Grund wird, um jemanden zu stoppen, der überhaupt nichts getan hat, aber »so aussieht, als könnte er ein Krimineller sein«, weil er Schwarz oder heute auch Muslim ist, wenn es keinen Grund gibt, jemanden zu verdächtigen und dieser Mensch trotzdem gestoppt wird – dann ist es Racial Profiling. Die Erfahrungsberichte der Menschen gaben uns
Aufschluss über die Kontrollen. Begründet wurden Stopps zum Beispiel mit »Du siehst aus wie eine gesuchte Person«. Aber wenn man genauer nachfragte, stellte sich heraus, dass sie eine 1,80 Meter große Person mit sehr dunkler Haut suchten, während sie gerade aber einen 1,60 Meter großen Mann kontrolliert hatten, der eher hellere Haut hat. Er sieht also überhaupt nicht aus wie die gesuchte Person. Die Kontrolle basiert allein darauf, welcher rassifizierten Gruppe die Person zugeordnet wird.
Welche Strategien haben die von Ihnen Befragten entwickelt, mit diesen ständigen Schikanen umzugehen?
Driving While Black beschreibt das Phänomen, dass Schwarze Autofahrer – besonders dann wenn sie ein neues teures Auto fahren – überdurchschnittlich häufig kontrolliert werden. Eine weit verbreitete Strategie Schwarzer Autofahrer ist es, ihre Hände sichtbar vom Lenker zu nehmen und hochzuheben, sobald die Polizei sie auffordert, an die Seite ranzufahren, damit diese sehen, dass sie keine Waffe haben. Oder die Fahrer öffnen das Autofenster und strecken ihre Hände raus. Manche Menschen haben ihren Ausweis im Handschuhfach. Eine Regel ist, dass du niemals selbst ins Handschuhfach greifst, um ihn hervorzuholen, sondern erst fragst: »Mein Ausweis ist im Handschuhfach, wollen sie ihn hervorholen?« Und nur wenn der Beamte anordnet, dass der Angehaltene es selbst tun soll, holt er den Ausweis aus dem Handschuhfach.
Was sagen Polizeibeamte zu Racial Profiling?
Ich konnte nur wenige befragen, denn die meisten sprechen ungern darüber. Verleugnung ist ein sehr machtvoller Mechanismus, der noch heute wirksam ist, obwohl die Existenz von Racial Profiling im Justizsystem zum Beispiel mittlerweile relativ anerkannt ist. Zu ihrer Verteidigung sagen Teile der Polizei immer noch, dass es kein Racial Profiling gibt. Die Forschung zeigt aber, dass sie es entgegen eigener Aussagen tun. Wenn Polizeibeamte angeklagt werden, ist es immer noch so, dass kein Gericht die Polizei verurteilt. Sie lügen füreinander, ändern ihre offiziellen Notizen oder »verlieren« sie.
Sehen Sie Strategien oder mögliche Allianzen, die effektiv sein könnten gegen Racial Profiling?
Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. In Kanada gibt es, wie in den meisten US-amerikanischen Staaten, zivilgesellschaftliche Kontrolle, aber sie ist nicht sehr weitgehend, da sie die undurchdringbare Wand der Polizeikultur nicht tangiert. Ich war auf vielen Konferenzen und die Polizei ist immer dabei. Das sind kooperative, freundliche Beamte, die dort etwas lernen sollen und wollen. Aber das ändert nicht ihr Verhalten oder die Polizeikultur, von der sie ein Teil sind. Deshalb frage ich mich: Allianzen mit wem? In vielen Staaten gibt es zivilgesellschaftliche Gruppen, die die Polizei einladen, um mit ihnen von Mensch zu Mensch zu sprechen, und das funktioniert, um die Beziehung zur Polizei zu verbessern – an der Praxis des Racial Profiling ändert das nichts.
Was bleibt ist also, die Betroffenenseite zu stärken.
Es ist vielleicht eine Frage der Entwicklung. Wir waren damals in einer Gruppe namens Black Action Defense Committee, die aus Schwarzen Aktivist_innen und weißen Unterstützer_innen bestand. Diese radikale Gruppe organisierte Proteste im Rahmen des Legalen und ging zu den Gerichtsprozessen. Sie sprachen niemals mit der Polizei. Um diese Gruppe ist es sehr still geworden. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die Leute keine Erfolge mehr sahen. Jetzt gibt es mehr Verhandlungen, zu denen die Polizei routinemäßig eingeladen wird, sodass es eine bessere Interaktion gibt. Ich gehe davon aus, dass auf eine Entwicklungsphase von Widerstand auch eine Phase folgt, in der man sich gezwungen sieht, mit der Polizei zu sprechen.
Über welche Bereiche aktivistischer Arbeit können Erfolge erzielt werden?
Wir haben auch Öffentlichkeitsarbeit geleistet und natürlich ist es nie genug, aber das Thema ist eindeutig präsenter als zuvor. Einige progressive Richter_innen akzeptieren, dass Anwält_innen anführen, ihre Mandant_innen seien Opfer von Racial Profiling geworden und lassen sie dafür Beweise vorbringen. Ein sehr großer Erfolg ist also meiner Meinung nach die Anerkennung durch das Gericht, das heißt, dass der Vorwurf des Racial Profiling in der Verteidigung zulässig ist. Allerdings betrifft das nur eine geringe Anzahl von Gerichten in Großstädten.
Welche wichtigen Änderungen in der polizeilichen Praxis gibt es, seitdem sie mit Carol Tator die Studie zu Racial Profiling in Kanada veröffentlicht haben?
Es gibt einige neue Techniken, die die Polizei in Kanada und den USA nutzt, wie zum Beispiel carding. Jedes Mal, wenn sie jemanden stoppen, müssen sie ein Formular ausfüllen, in dem auch race und Ethnizität der Kontrollierten vermerkt wird. Das ist nützlich für die Forschung, um zu zeigen, dass rassistisch selektiert wurde, aber einfach nicht logisch.
Dass eine Handlung als Racial Profiling erkennbar wird, ist ja schon das Resultat eines rassistisch motivierten Stopps. Wir erheben dann zum Beispiel über einen achtzehnmonatigen Zeitraum Daten und zeigen: Ja, sie haben mehr Schwarze und People of Colour als weiße Menschen kontrolliert, also hat Racial Profiling stattgefunden. Aber dann ist es ja schon zu spät, diese Leute wurden schon kontrolliert.
Gibt es noch andere Möglichkeiten für kritische Wissenschaftler_innen, Racial Profiling nachzuweisen?
Es ist fast unmöglich, jenseits der Auswertung des carding verlässliche Daten zu erheben. Die Institution der Polizei ist dafür nicht offen. Wenn du den Beamten zeigst, dass sie Schwarze Menschen häufiger kontrolliert haben, sagen sie: »Das haben wir ja nicht getan, weil wir rassistisch selektieren, sondern weil sie möglicherweise in kriminelle Aktivitäten involviert waren.« Man kann immer nur rückblickend erheben und ist dann mit diesen Rechtfertigungsstrategien konfrontiert. Also geht man zu den Betroffenen, deren geschilderte Erfahrungen aber in der Forschung als subjektive, anekdotenhafte Beweise gesehen werden. Wir wissen, dass Racial Profiling als Prinzip in der Polizeiarbeit existiert, aber dieses Wissen ist nicht gleichbedeutend mit dem
wissenschaftlichen Nachweis, der bezeugt, dass es existiert.
Interview: Hannah Schultes und Sebastian Friedrich