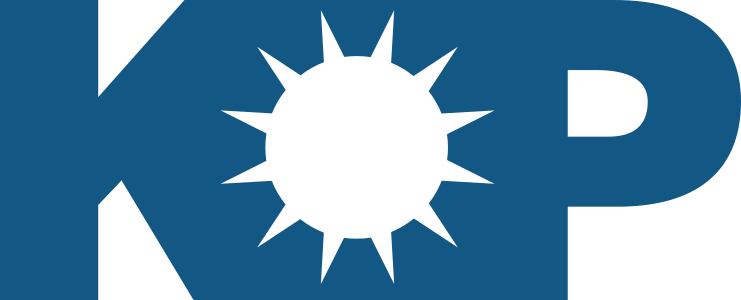- Tag X rückt näher
Nach Monaten des Wartens und der Verzögerungen tut sich wieder etwas im NSU-Prozess. Am 24. April begannen die Plädoyers der Verteidigung. Zuerst plädierten die neuen Verteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, Borchert und Grasel. Es folgen die Plädoyers der Verteidiger*innen von Carsten Schultze, André Eminger, Holger Gerlach und Ralf Wohlleben. Zum Schluss sind die Altverteidiger*innen von Beate Zschäpe an der Reihe.
Borcherts Plädoyer ließ erkennen, wie wenig Ahnung er von organisiertem Rechtsterrorismus hat. Beispielsweise bezweifelte er, dass der NSU den rassistischen Plan verfolgte, mit Morden und Sprengstoffanschlägen ohne Bekennerschreiben in migrantischen Communities Angst und Schrecken zu verbreiten, um diese letztlich aus Deutschland zu vertreiben. Diese Vorgehensweise würde doch gar keinen Sinn ergeben, wenn die Opfer nicht wüssten, wer die Täter seien. Dass Anschläge ohne Bekenntnis zu dieser Zeit eine vieldiskutierte Strategie unter Neonazis waren und entsprechende Dokumente auch bei den Mitgliedern des Kerntrios gefunden wurden, ignorierte Borschert. Das Beispiel gibt einen Vorgeschmack von dem, worauf wir uns in den kommenden Wochen bei den Plädoyers der Verteidiger*innen einstellen müssen: Auf die erneute Verharmlosung der Taten des NSU, die Ausblendung von Rassismus und neonazistischer Gewalt – bis hin zu rechter Propaganda.
Das Urteil könnte noch im Juni verkündet werden. Gemeinsam mit anderen Gruppen rufen wir dazu auf, zur Urteilsverkündung in München auf die Straße zu gehen und deutlich zu machen, dass wir keinen Schlussstrich akzeptieren werden. Eine umfassende Aufklärung der Taten des NSU steht noch aus! Das Ende des Prozesses darf nicht bedeuten, dass wir aufhören, uns mit dem NSU und der Gesellschaft, die ihn möglich machte, auseinanderzusetzen.
- Eskalierende Polizeigewalt gegen Geflüchtete
„Die Polizei – Unser Freund“?
Stellungnahme zu den Todesschüssen auf einen Geflüchteten in Fulda
In den frühen Morgenstunden des 13. April erschießt im osthessischen Fulda ein Polizeibeamter einen 19-jährigen. Letzterer hatte zuvor randaliert, einen Menschen angegriffen und verletzt. Als die Streifenwagen eintreffen, flieht der Angreifer. Es folgt eine Auseinandersetzung zwischen ihm und der Polizei. Dabei fallen 12 Schüsse – zwei davon sind tödlich. Die Polizei gibt an, mit Steinen und einem Schlagstock angegriffen worden zu sein. Das LKA ermittelt, überprüft, ob ein Tötungsdelikt vorliegt und ob Notwehr in Frage kommt. Das Todesopfer war ein Geflüchteter aus Afghanistan, der in einer Geflüchteten-Unterkunft in der Nähe wohnte.
In Fällen von tödlicher Polizeigewalt berufen sich die Täter*innen in der Regel auf Notwehr. Ermittlungen werden meist eingestellt, obwohl es häufig höchst fraglich ist, ob ein tödlicher Schuss wirklich das einzige Mittel war, eine Gefahr abzuwenden. Auch in Fulda ist das Argument „Notwehr“ zweifelhaft: Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sich vier Beamte vor einem nur mit einem Stock bewaffneten Jugendlichen, der bereits vor ihnen Reißaus genommen hatte, nicht anders schützen konnten, als diesen mit 12 Schüssen niederzustrecken.
Um den Fall ist eine hitzige Debatte entstanden. Einige stellen die wichtige Frage nach der Verhältnismäßigkeit polizeilicher Gewalt. Insbesondere eine Initiative von Geflüchteten aus der Fuldaer Unterkunft demonstrierte wenige Tage nach dem Vorfall in der Innenstadt und forderte Aufklärung und Gerechtigkeit. Viele andere stürzen sich aber vor allem auf die Tatsache, dass es sich bei dem Opfer um einen Geflüchteten gehandelt hat und dass dieser schon vorher mit Gewalttaten aufgefallen sein soll. Rassistische Stereotype vom „aggressiven Ausländer“ werden bemüht, Menschen, die die Maßnahmen der Polizei kritisieren, bedroht und beleidigt. Unter dem Motto „Die Polizei – unser Freund“ nutzt die AfD den Vorfall, um gegen Geflüchtete Stimmung zu machen und sich schützend vor die deutsche Polizei zu stellen.
Völlig unterbelichtet bleibt bei der Debatte, dass Menschen in psychischen Ausnahmesituationen besonders häufig Opfer von polizeilichen Todesschüssen werden und dass die nicht adäquate Versorgung und Unterbringung von häufig auch traumatisierten Geflüchteten gewaltsame Konflikte begünstigt und provoziert. Tödliche Vorfälle wie der in Fulda sind also nicht dem Versagen einzelner überforderter Polizeibeamt*innen zuzuschreiben, sondern haben strukturelle Ursachen: Institutioneller Rassismus und das Lagersystem produzieren erst Menschen, die ins rassistische Klischee des „aggressiven Ausländers“ passen und dann zum Abschuss freigegeben werden.
Wir solidarisieren uns mit der Kampagne der Geflüchteten aus Fulda und fordern eine lückenlose Aufklärung der Todesschüsse von Fulda sowie eine Auseinandersetzung mit den Ursachen von tödlicher Polizeigewalt.
Solidarität mit den Geflüchteten in Ellwangen
Am 30. April verhinderten Bewohner*innen der Landeserstaufnahmeeinrichtung im baden-württembergischen Ellwangen die Abschiebung eines Mannes aus Togo nach Italien. Er sollte gemäß der Dublin-Verordnung nach Italien überstellt werden, obwohl viele Flüchtlinge dort aufgrund gravierender Mängel im Asylsystem auf der Straße leben müssen. Drei Tage später kam es in der Unterkunft zu einem Großeinsatz der Polizei. Bewaffnete und maskierte Spezialeinheiten stürmten die Einrichtung am frühen Morgen. Sie nahmen den Mann aus Togo fest, beschlagnahmten Bargeld und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein. Mehrere Bewohner*innen der Unterkunft wurden verletzt, zwei davon, weil sie aus Panik aus dem Fenster sprangen. Wie so oft stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Polizei Tatsachen verdreht hat, um die eigene Gewaltausübung zu rechtfertigen. So wurden in der Unterkunft keine Waffen gefunden, die die Bewohner*innen dort angeblich gehortet hätten und kein Polizist wurde entgegen ursprünglich anderslautender Behauptungen durch Flüchtlinge verletzt. Die Klarstellungen taten allerdings der hetzerischen Debatte, die längst in Gang war, keinen Abbruch. Darin überboten sich Politiker*innen gegenseitig mit Forderungen nach noch mehr Kontrolle, noch mehr Restriktion und noch mehr Härte im Umgang mit Geflüchteten.
Der brutale Großeinsatz der Polizei erfüllt aus unserer Sicht zwei Funktionen: Erstens werden damit gezielt Bilder von angeblich kriminellen und gewalttätigen Geflüchteten geschaffen. Die dahinter stehende Botschaft ist eindeutig: Flüchtlinge sind Kriminelle, die zu Recht und zum Schutz der „rechtstreuen Bevölkerung“ in entlegene Lager gesperrt werden. Zweitens verfolgte der Polizeieinsatz das Ziel, Menschen, die die Entrechtung im Lager nicht länger widerstandslos hinnehmen wollten, einzuschüchtern. Etwas Ähnliches hat sich Mitte März im bayrischen Donauwörth ereignet. In der dortigen Unterkunft hatten sich Geflüchtete aus Gambia über Monate getroffen, um sich gegen die Entrechtung im Lager und gegen Abschiebungen zu organisieren. Im Rahmen eines brutalen Polizeieinsatzes wurden dreißig der aktiven Refugees festgenommen, viele von ihnen sind bis heute in U-Haft.
Wenn Menschen solidarisch zusammenstehen und sich organisieren, um sich gegen unerträgliche Lebensbedingungen zur Wehr zu setzen, dann sind sie keine „Unruhestifter“, sondern politisch Handelnde, die das rassistische Lagersystem in Frage stellen und ihre Rechte einfordern. Wir sind schockiert über die fortschreitende Eskalation der (Polizei-)Gewalt und solidarisieren uns mit den Geflüchteten in Ellwangen und Donauwörth. Wir fordern ein Ende der Politik der rassistischen Kriminalisierung. Lager abschaffen! Polizeigewalt abschaffen!
- Prozessberichte
Bamberg: Prozess gegen Opfer von Security-Gewalt ausgesetzt
Amtsgericht Bamberg am 27. März: Zwei senegalesische Geflüchtete stehen vor Gericht. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung gegen Mitarbeiter des privaten Wachdienstes Fair Guards (bzw. dessen Subunternehmen) vorgeworfen. Das ist für die Angeklagten eine zynische Verdrehung der Tatsachen. Aus ihrer Sicht ist folgendes geschehen: Sie wurden im September 2017 Zeugen eines brutalen Angriffs durch eine Gruppe von Mitarbeitern des Wachdienstes gegen einen dritten senegalesischen Asylbewerber. Das Opfer wurde mit extremer Gewalt zu Boden gebracht und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Als sie sich den Security-Angestellten näherten, um deren Brutalität zu kritisieren, wurde einer von ihnen ebenfalls mit Gewalt zu Boden gebracht, in Handschellen gefesselt und weiter misshandelt. In der Folge kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Die herbeigerufenen Polizeibeamt*innen nahmen jedoch nur die Aussagen des Wachpersonals auf und ignorierten die Aussagen der Opfer. Später erhielten die Geflüchteten Strafbefehle. Weil sie diese nicht akzeptierten, kommt es nun zum Prozess.
Die Verhandlung wird jedoch nach nur wenigen Minuten ausgesetzt, um Anträge der Verteidigung zu überprüfen. Diese sollen zeigen, dass in der Aufnahmeeinrichtung Oberbayern (AEO) in Bamberg Geflüchtete systematisch durch den Wachdienst misshandelt werden.
Die Firma Fair Guards und ihre Subunternehmen sind wegen solcher Übergriffe bekannt. Wegen eines Angriffs läuft seit Oktober 2017 gegen vier ehemalige Mitarbeiter ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Unter den Vieren sind auch einige der Zeugen, die im Prozess vom 27. März gegen die zwei beschuldigten Geflüchteten aussagen sollen. In einem weiteren Fall wurde einem Geflüchteten mit so großer Wucht ins Gesicht geschlagen, dass ihm mehrere Zähne abbrachen. Eine Justizwatch-Aktivistin hatte Kontakt zu zwei ehemaligen Wachdienstmitarbeitern der Einrichtung, die bezeugen, dass ein „Sonderteam“ aus Fair Guards-Angestellten gezielt Geflüchtete provozierte, um sie danach zu schlagen und zu fesseln. Beschwerden bei der Heimleitung blieben folgenlos.
Die AEO Bamberg ist Modell der derzeit bundesweit geplanten „AnkER-Zentren“ und gilt als „Vorzeigelager“ der CSU-geführten Landesregierung. Menschen mit so genannter „schlechter Bleibeperspektive“ können dort bis zu zwei Jahre kaserniert werden. Sie dürfen keine Deutschkurse besuchen, keine reguläre Arbeit aufnehmen und erhalten oft nicht einmal eine Duldung. Kontakte zu solidarischen Unterstützer*innen sind kaum vorhanden.
Wir begleiten und unterstützen die beiden Angeklagten bei ihrem Prozess. Für Verfahrens- und Kampagnenkosten bei der Unterstützung weiterer Opfer des gewalttätigen Wachpersonals benötigen wir dringend Geld. Monetäre Solidaritätsbekundungen können auf folgendes Konto geleistet werden:
Bayerischer Flüchtlingsrat
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE89 7002 0500 0008 8326 02
BIC: BFSWDE33MUE
Verwendungszweck: „Bamberg Securityverfahren“
„Ziegenprozess“
Amtsgericht Tiergarten, 28. März 2018. Zwei Männer aus Rumänien sitzen auf der Anklagebank. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Diebstahl mit Waffe und Tötung eines Tieres ohne vernünftigen Grund. Die beiden Männer hatten im Februar im Tiergehege der Hasenheide in Berlin-Neukölln eine Ziege getötet – in der Absicht, sie zu essen. Zuvor kamen sie aus Rumänien nach Berlin, um auf einer Baustelle zu arbeiten. Um ihren Lohn geprellt hatten sie kaum Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen.
Der Zuschauer*innenbereich im Gerichtssaal ist an diesem Tag voll besetzt. Neben Mitgliedern der Tierschutzorganisation „PETA“ interessiert sich vor allem die Boulevardpresse für den Vorfall. „Tiermörder“ und „Ziegenkiller“ lauten die reißerischen Titel. Anstatt die Hintergründe der „Tat“ zu beleuchten – Armut, prekäre Jobs und soziale Ausgrenzung in einem reichen Land – prangern die Journalist*innen das Verhalten von zwei mittellosen Menschen an. Ganz so, als würden in Deutschland nicht gut 60 Kilo Fleisch pro Jahr und Kopf verzehrt und als gäbe es in dieser Gesellschaft keine Tierquälerei durch industrielle Massentierhaltung. Aber niemand schreit „Tiermörder“, wenn fertig abgepackte, billige Tierprodukte aus den Supermarktregalen entnommen werden.
Das Gericht lässt sich offenbar von der moralisierenden Debatte mitreißen und verurteilt die Angeklagten am 4. April zu mehrmonatigen Haftstrafen ohne Bewährung. Die Sozialprognose sei ungünstig: Die Männer seien bereits kurz nach ihrer Einreise straffällig geworden, außerdem hätten sie weder einen festen Wohnsitz noch geklärte Arbeits- und Einkommensverhältnisse. Aus unserer Sicht ist das ein typischer Fall von Klassenjustiz: Menschen werden in äußerst prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse gezwungen – und diese werden ihnen dann zum Vorwurf gemacht. Die Angeklagten gehen gegen das Urteil in Berufung. Wir werden das Verfahren weiter begleiten.
Rassistischer Übergriff durch privaten Sicherheitsdienst
Im Prozess gegen Herrn Samu haben weitere Verhandlungstage stattgefunden. Herrn Samu wird vorgeworfen, sich einer Kontrolle seines Tickets in einer Berliner S-Bahn widersetzt zu haben. In der Absicht zu fliehen soll er die Kontrolleur*innen eines privaten Sicherheitsdienstes körperlich angegriffen zu haben. Herr Samu bestreitet die Vorwürfe.
Der Prozess läuft seit November 2017 und gestaltet sich unerwartet lang. Der Verteidiger und Herr Samu deckten in den Verhandlungstagen immer wieder entscheidende Widersprüche und Ungenauigkeiten in den Aussagen der Belastungszeug*innen auf. So konnte keiner der Kontrolleur*innen den Moment beschreiben, in dem Herrn Samu angeblich weglaufen wollte. Dies wäre aber entscheidend, da die Kontrolleur*innen diesen Moment als Grund für die Ausübung von Gewalt gegen Herrn Samu darstellen. Ein Ehepaar aus Bayern, das den Vorfall beobachtete, will gesehen haben, wir der Beschuldigte einen Kontrolleur unvermittelt gegen die Schulter geschlagen hat. Von einem Schlag gegen die Schulter war aber nicht einmal in den Aussagen der vermeintlich betroffenen Kontrolleur*innen die Rede. In schriftlichen Aussagen, die die Eheleute nach dem Vorfall einreichten, stellen sie Herrn Samu als gewalttätig und aggressiv dar, das Verhalten der Kontrolleur*innen beurteilen sie hingegen als angemessen und professionell. In ihren Aussagen wiederholt sich damit ein Muster, das sich durch den gesamten Prozess zieht: Immer wieder wird Herr Samu so beschrieben, als habe er sich aggressiv und rücksichtslos verhalten, zugespitzt in dem Vorwurf, er habe nach dem Vorfall ein seinen Kindern gereichtes Taschentuch weg geschlagen. Auf Nachfrage des Verteidigers stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Schlagen, sondern um ein Ablehnen handelte. Herr Samu fügte hinzu, dass das Taschentuch von einer der Kontrolleur*innen kam, die ihn zuvor brutal zu Boden gebracht hatten.
Die rassistische Opfer-Täter-Umkehr, die dem gesamten Prozess zugrunde liegt, wird in der Hauptverhandlung an keiner Stelle in Frage gestellt. Weder Zeug*innen noch die Staatsanwältin oder der Richter ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass sich die weißen Kontrolleur*innen falsch verhalten haben könnten, indem sie Herrn Samu angegriffen haben.
Die Plädoyers und das Urteil sollen beim nächsten Termin am 16. Mai um 14 Uhr in Raum 672 im Amtsgericht Tiergarten gesprochen werden. Solidarische Prozessbeobachtung ist erwünscht!
Berufungsverfahren im „Blauer Parka-Prozess“
Landgericht Berlin, 4. Mai 2018. Wir beobachten die Berufungsverhandlung gegen einen jungen Mann aus Guinea-Bissau. Ihm wird vorgeworfen, gewerbsmäßig mit Marihuana gehandelt zu haben. Zwei Polizist*innen aus NRW, die zufällig zu Besuch in Berlin durch den Görlitzer Park spazierten, wollen gesehen haben, wie er sich auf der Flucht vor der Polizei aus einer Gruppe heraus am Görlitzer Park eines Päckchens mit Marihuana entledigt hat. Eine ältere Dame mit Hund soll auf ein weiteres Versteck im Busch hingewiesen haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er vermutet, dass er von den Beamt*innen verwechselt wurde. In der ersten Instanz wurde er zu einem Jahr und 5 Monaten Haft verurteilt. In der Berufung fordert die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft ohne Bewährung, die Verteidigung fordert einen bedingungslosen Freispruch.
Wie so oft strukturiert das Verhalten der Polizei den Prozess entscheidend vor: Über einen Aktenvermerk stellte sich im Prozess heraus, dass die Beweismittel allesamt vorschriftswidrig vom LKA Berlin vernichtet wurden – bevor Fingerabdrücke, die den Angeklagten hätten entlasten können, abgeglichen wurden. Auch kann nicht mehr geklärt werden, wie viel Gramm Marihuana an welcher der beiden Fundstellen aufgefunden wurde, da das Beweissicherungsprotokoll mangelhaft und der Verbleib des zweiten Päckchens ungeklärt ist. Die einzige Augenzeugin des zweiten Verstecks – die alte Dame mit Hund – bleibt ein Rätsel: Ihre Personalien wurden nicht aufgenommen.
Auch als Zeug*innen in der Hauptverhandlung machen die Beamt*innen eine zweifelhafte Figur. Niemand kann den Angeklagten einwandfrei identifizieren: „Schwarzafrikaner“ mit blauem Parka ist das einzige vage Wiedererkennungsmerkmal, auf das sich die Beamt*innen im Zeugenstand berufen. Schon in der ersten Instanz hatten wir daher den Verdacht, dass die Beamt*innen eine beliebige schwarze Person festgenommen haben, um ihren Drogenkriminalitätsbekämpfungseinsatz „erfolgreich“ zu beenden. Darüber hinaus kommt es zu einer ganzen Reihe von Widersprüchen in den Aussagen der Polizeizeug*innen. Während ein Beamter auf die simple Frage des Verteidigers, wie er sich auf die Sitzung vorbereitet habe, lautstark zu Protokoll gibt, dass er sich entschieden gegen den Vorwurf wehre, er spreche Aussagen mit Kollegen ab, gibt seine aufbrausende Kollegin in der darauffolgenden Vernehmung zur Überraschung des Gerichts und aller Beteiligten an, dass sie nach diesen Erfahrungen vorhabe, sich zukünftig immer abzusprechen. Vor dem Sitzungstermin dieser Hauptverhandlung hätten umfangreiche Absprachen stattgefunden, und es gebe sogar eine WhatsApp-Gruppe der beteiligten Beamt*innen.
Was hängen bleibt: In einer Aussage-gegen-Aussage Konstellation kommen Polizeizeug*innen im Strafprozess eine bedeutende Rolle zu. Ohne verwendbare Beweismittel hängt die Verurteilung letztendlich am Beweiswert ihrer Aussagen. Umso tragischer, wenn sich dann herausstellt, dass die Aussagen – wie in diesem Prozess – womöglich ein Produkt interner Absprachen sind.
Das Urteil wird am 25.05.18 13:30 Uhr in Raum 618 in der Turmstr. 91 gesprochen. Solidarische Prozessbeobachtung ist erwünscht!
Prozess gegen die Moria 35
Am 27. April endete auf Chios (Griechenland) der Prozess gegen die Moria 35. 32 der 35 Angeklagten wurden zu 26-monatigen Gefängnisstrafen verurteilt. Hintergrund des Verfahrens sind Proteste von Geflüchteten gegen die unerträglichen Zustände im Lager Moria auf Lesbos. Im Juli 2017 gingen hunderte Geflüchtete verschiedenster Nationalitäten gegen miserable Lagerbedingungen und für Bewegungsfreiheit auf die Straße. Die Polizei griff den friedlichen Protest mit Tränengas an. Etwa eine Stunde später stürmten Beamt*innen das Lager Moria und riegelten die Bereiche ab, in denen überwiegend Menschen afrikanischer Herkunft untergebracht waren. Auf Videos ist zu sehen, wie die Polizei Tränengas versprüht und bereits gefesselte Personen brutal zusammenschlägt. Sogar eine schwangere Frau wurde Opfer des Übergriffs. Medizinische Hilfe gab es keine, stattdessen folgten Anzeigen gegen 35 festgenommene Männer.
Viele der Festgenommenen waren jedoch gar nicht an den Protesten beteiligt. Die Geflüchteten sowie Anwält*innen vermuten, dass die Polizei willkürlich Schwarze Männer festnahm, die sich zu Zeitpunkt des Angriffs in dem abgeriegelten Teil des Lagers aufhielten. Die Anklage gegen die Moria 35 zeigt aus unserer Sicht, dass hier Opfer von rassistischer Polizeigewalt zu Tätern gemacht werden sollen.
Durch die Verlegung des Prozesses von Lesbos nach Chios wurde im Nachgang versucht, politische Solidarität mit den Moria 35 zu unterbinden. Tatsächlich verhinderte ein Fährstreik, dass solidarische Menschen zum Verhandlungsbeginn nach Chios fahren konnten. Auch zwei der Angeklagten sowie die vereidigten Dolmetscher*innen für Wolof und Bambara konnten nicht anreisen. Übersetzt wurde dann von einem spontan aus dem nahegelegenen Lager Vial herangeholten Geflüchteten, der allerdings einen anderen Dialekt sprach; die abwesenden Angeklagten beauftragten bereits anwesende Rechtsanwälte, sie zu vertreten. Unzureichende Übersetzungen prägten auch den weiteren Verlauf der Verhandlung. Die Aussagen der Polizeizeug*innen wirkten abgesprochen, und insgesamt wurde der Darstellung des Geschehens aus Sicht der Angeklagten und entlastender Zeug*innen viel zu wenig Raum gegeben.
Trotz dieser gravierenden Verfahrensmängel und obwohl keiner der Angeklagten individuell identifiziert werden konnte, wurden 32 von ihnen der Körperverletzung gegen einen Polizeibeamten schuldig gesprochen. Die Verteidigung legte unmittelbar nach Prozessende Berufung gegen das Urteil ein. Sie sieht darin genau wie das internationale Komitee von Prozessbeobachter*innen ein Signal des griechischen Staats, dass kollektiver Widerstand gegen das Grenzregime nicht geduldet wird.
Europaweit erleben wir eine Welle der Repression gegen Geflüchtete und ihren politischen Protest, mit der ein Exempel der Abschreckung statuiert werden soll – gegen die Moria 35, die Röszke 11, die Geflüchteten in Bamberg, Ellwangen, Donauwörth und an vielen anderen Orten. Deswegen halten wir es für besonders wichtig, uns mit den Betroffenen solidarisch zu zeigen und deutlich zu machen, dass wir mit dieser Politik der rassistischen Kriminalisierung nicht einverstanden sind!