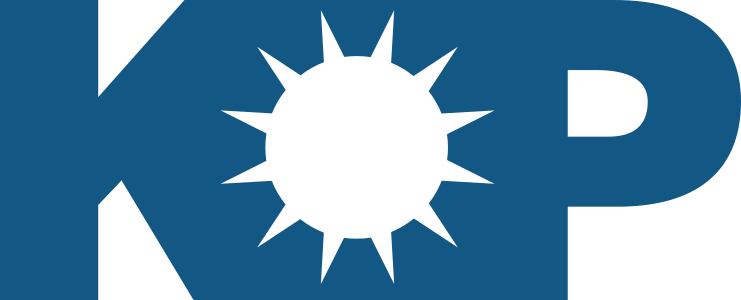Was war passiert?
Am 21. März 2012 ist Frau Eliana B. auf dem Weg, ihre siebenjährige Tochter zur Schule zu bringen. Sie schiebt ihr Fahrrad, auf dem Gepäckträger sitzt ihre Tochter. Frau B. wird von einem Mann angehalten und darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Tochter nicht auf dem Gepäckträger sitzen dürfe. Frau B. lässt die Tochter absteigen und will ihren Weg fortsetzen, um pünktlich zum Unterrichtsbeginn in der Schule zu sein. Doch der Mann hindert sie daran, indem er sie an ihrer Hand festhält, diese kräftig und für sie schmerzhaft auf den Fahrradlenker drückt und sie zudem fragt, woher sie komme. Aufgrund ihres Akzents geht der Mann vermutlich davon aus, dass sie keine „Deutsche“ ist. Es kommt zu einem erregten Wortwechsel, Frau B. ruft um Hilfe, sie sieht sich diskriminiert und rassistisch beleidigt. Für Frau B. ist nicht ersichtlich, weshalb der Mann sie am Weitergehen hindert. Sie schafft es schließlich, ihre Hand zu lösen und ihre Tochter verspätet zur Schule zu bringen. In der Schule erklärt sie den Grund für ihre Verspätung, trifft aber nur auf Unverständnis seitens der Lehrerin. Der Mann, der Frau B. angehalten hatte, sucht später die Schule auf. Erst dort gibt er sich als Polizeibeamter zu erkennen und holt die Tochter von Frau B., ohne deren Kenntnis und Erlaubnis, aus dem Unterricht, um sie im Beisein der Lehrerin zu befragen. Erst als Frau B.s Tochter ihrer Mutter davon berichtet, wird Frau B. klar, dass es sich bei dem Mann, der sie am Morgen festgehalten hatte, um einen Polizeibeamten handelte. Im weiteren Verlauf muss das siebenjährige Mädchen die Schule wechseln, da sich diese Polizeimaßnahme sehr zum Nachteil für sie auswirkte. (siehe Chronik, S. 145)
Obwohl sich der Polizeibeamte, nicht als solcher zu erkennen gab und Frau B. an der Hand verletzte, kam Frau B. seinen Anordnungen nach und ließ ihre Tochter sofort absteigen. Dennoch muss sie sich jetzt wegen „Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ und „Körperverletzung“ vor Gericht verantworten. „Diese Vorgehensweise der Polizei begegnet uns in unserer Arbeit immer wieder“, berichtet Biplab Basu von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, „Menschen, die Opfer von rassistischem Handeln der Polizei werden, werden als Täter_innen angeklagt und somit kriminalisiert. Diese Vorgehensweise des Polizeibeamten ist völlig inakzeptabel.“
Die Befragung von Kindern durch die Polizei ohne das Beisein und die Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten ist ein klarer Verstoß gegen geltendes Polizeirecht und andere rechtsstaatliche Prinzipien. Die polizeiliche Maßnahme, ein Kind wegen einer geringfügigen Verkehrswidrigkeit aus dem Schulunterricht zu holen und zu befragen, verstößt zudem gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. „Mit zunehmender Sorge beobachten wir seit einigen Jahren, die Vermischung von polizeilichen Ordnungsaufgaben und pädagogischem Handeln in Schulen“, kritisiert Angelina Weinbender vom Migrationsrat, „Die Befragung der kleinen Tochter von Frau B. zeigt deutlich, dass von Polizeibeamt_innen kein kompetentes pädagogisches Handeln zu erwarten ist und lässt uns zudem auch an den pädagogischen Fähigkeiten der Berliner Lehrkräften zweifeln.“
Bericht zur Prozessbeobachtung
Noch bevor die Verhandlung begann erklärte die Richterin, dass sie nicht verstehe, weshalb ein solcher Fall überhaupt vor Gericht verhandelt werden solle. Aus diesem Grund wollte sie mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung das Verfahren nach § 153 StPO einstellen. Der Staatsanwalt, welcher sich noch in Ausbildung befindet, musste dies erst mit seinem Ausbilder telefonisch abklären. Das Ergebnis war, dass die Staatsanwaltschaft sich nur auf eine Einigung mit Auflagen einlassen konnte. Die Verhandlung wurde somit eröffnet, obwohl die Richterin mit ihrer Aussage „Ganz ehrlich, ich finde dieses Verfahren abartig. […] Muss man so jemanden wie ihre Mandantin verurteilen? Ich werde das nicht verurteilen.“ ihre Zweifel deutlich äußerte.
Da die ganze Situation für die Angeklagte eine erhebliche Belastung bedeutete, tätigte der Verteidiger die Aussage für seine Mandantin und nahm darin Stellung zu dem aus der Anklageschrift zu entnehmden Tatvorwurf. Die einzigen Fragen, die diesbezüglich von der Staatsanwaltschaft an die Angeklagte gerichtet wurden, betrafen die Personalienabfrage durch den Polizeibeamten. Die Angeklagte erklärte, dass der Beamte sie nach ihren Personalien gefragt habe, sie ihm diese aber nicht genannt habe, da sie auch seine nicht kannte und demnach nicht wusste, wer er war. Der Staatsanwalt äußerte in diesem Fall sein Unverständnis, er könne nicht nachvollziehen, weshalb die Angeklagte nicht einfach nachgefragt hätte.
Der Zeuge Hartmut J. wurde hereingebeten. Er erklärte, dass er als Präventionsbeamter eingesetzt und seine Aufgabe die Überwachung des Schulwegs sei. Er begann, die Situation aus seiner Sicht zu schildern und machte immer wieder deutlich, dass es ihm um die „Gefahrenabwehr“ ging. „Mein Ziel war es erstmal, dass das Kind gefahrlos vom Fahrrad runterkommt.“ Er erklärte, dass er in die Schule der Tochter der Angeklagten gegangen sei, um die Personalien der Mutter herauszufinden. Damit habe er sich für die gewaltärmere Form entschieden, schließlich sei er als männlicher Beamter allein unterwegs gewesen und hätte die Angeklagte zu Boden bringen und fixieren müssen, um auf eine weibliche Kollegin für die Durchsuchung zu warten. Er habe aber davon abgesehen, da ihm bekannte, vorbeigehende Kinder ihm signalisiert hätten, dass das Mädchen auf ihre Schule gehe. Aufgrund des auffälligen Fahrradhelms des Mädchens sei er sich somit sicher gewesen, das Kind in der Schule wiederzuerkennen.
Weiterhin schilderte der Zeuge J., dass er Frau B. mit einer „direkten Ansprache“, einem entsprechenden Handzeichen und der Aussage „einmal bitte ranfahren“ auf der Straße gestoppt hätte. Doch Frau B. hätte sofort gesagt, dass er das nicht dürfe, dass sie keine Zeit hätte. Ihre Aussagen seien schnell in die Richtung „Macht/Staat/Polizei“ und dass er seine Macht ausnutze, gegangen. Dabei hätte er ihr nur deutlich machen wollen, dass es ihm um die Sicherheit des Kindes und von Frau B. ginge. Frau B. hingegen hätte sofort geschrien, wodurch eine „normale Kommunikation“ nicht mehr möglich gewesen sei. „Die entsetzten Augen des Kindes habe ich bis heute nicht vergessen.“ Es hätte dann ein Gerangel zwischen ihm und der Angeklagten gegeben, wobei er von Frau B. an der Hand gekratzt worden sei, auch eine Ausholbewegung mit der Hand hätte sie in Richtung seines Kopfes gemacht. Woraufhin der Zeuge J. sich gefragt habe, ob er die Frau jetzt fesseln und zu Boden bringen müsse. Auf Nachfrage der Richterin erklärte der Zeuge J., er könne nicht mehr sagen, ob durch ihn eine Rechtsbelehrung für Frau B. erfolgte oder nicht.
Die Schule hätte der Polizeibeamte J. mit einem Kollegen und einer Kollegin später aufgesucht, mit dem Ziel das Mädchen mit dem auffälligen Fahrradhelm zu finden. Er sei dann auf eine Lehrerin getroffen, die ihn auf die Erzählungen einer Mutter bezüglich eines Vorfalls mit einem Fahrrad angesprochen habe. Die Lehrerin habe ihm den Namen und die Klasse der Tochter dieser Frau genannt. So habe er die Tochter von Frau B. ausfindig gemacht. Mit dem Mädchen habe er an der Tür zum Klassenraum gesprochen, sie saß zuvor mit Klassenkamerad_innen an einem Tisch, ob Unterricht oder Pause war, könne der Zeuge J. nicht sagen. Er habe dann dem Mädchen erklärt, dass der Vorfall am Morgen nichts mit ihr zu tun habe, sondern es sich um eine Sache zwischen ihm und ihrer Mutter handelte. Dies sei ihm wichtig gewesen, damit das Mädchen bei seiner nächsten Präventionsveranstaltung in der Klasse keine Angst vor ihm habe und die Beziehung zu dem Kind, der Klasse und der ganzen Schule darunter leide.
In Bezug auf die Verletzungen, die die Angeklagte B. in Folge des Gerangels zu beklagen hatte, äußerte der Zeuge J. sich folgendermaßen: „Verletzungen? Naja, ich habe sie festgehalten, nichts weiter.“. Des Weiteren wurde er dahingehend befragt, ob er der Angeklagten seinen Namen oder seine Dienstnummer genannt hätte? Daraufhin erklärte er, dass er seine Dienstnummer oder Visitenkarte immer auf Anfrage herausgebe, eine konkrete Antwort auf die Frage lieferte er aber nicht. Im weiteren Verlauf betonte der Zeuge mehrmalig, dass die „Abwehr einer konkreten Gefahr“ die Grundlage und Intention seines Handelns darstellte.
Die Verteidigung befragte den Polizeibeamten J., ob er um die Voruassetzungen für das Anwenden von Gewalt wisse und ob er schon einmal etwas davon gehört habe, dass eine Zwangsanwendung immer angedroht werden müsse? Als der Zeuge daraufhin entgegnete, dass ihm dies in diesem Moment nicht möglich war, antwortete die Verteidigung mit der Frage „Wozu gibt es dann diese Vorschriften?“. Bezüglich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erklärte der Zeuge J. selbstsicher, dass er diesem nachgekommen sei, woraufhin die Verteidigung etwas hämisch fragte, ob er es sich tatsächlich hoch anrechne, dass er Frau B. nicht gefesselt habe. Der Zeuge bejahte. Bezüglich der Personalienabfrage erklärte Herr J., dass dies eine Standardmaßnahme sei, dass er sich in diesemkonkreten Fall nicht mehr daran erinnern könne, aber dass er dies immer mache. Der Verteidiger äußerte jedoch seine Zweifel daran, schließlich sei in dem sonst so sehr ausführlichen Bericht des Polizeibeamten J. mit keinem Wort die Personalienabfrage erwähnt.
Die Richterin entließ den Zeugen J. und verzichtete auf die Anhörung der weiteren Zeugen, sie habe genug gehört.
In seinem Abschlussplädoyer beschrieb der Staatsanwalt den Zeugen J. als glaubhaft, er habe im Zusammenhang erzählt, nichts konstruiert. Die Tatsache, dass die Personalienabfrage nicht im Bericht des Zeugen aufgeführt wird, mache für ihn Sinn, da es sich um eine Standardmaßnahme handele. Dennoch habe der Zeuge seine Position als Präventionsbeamter in der Schule ein bisschen ausgenutzt. Dass die Angeklagte ein gewisses Misstrauen gegenüber Polizisten habe, würde sich strafmildernd auswirken. Die Staatsanwaltschaft könne jedoch keine Anhaltspunkte dafür sehen, dass die Strafe in Bezug auf § 113 StGB für die Angeklagte gemildert werde. Er könne deshalb keine Einstellung und keinen Freispruch beantragen, jedoch sei zu berücksichtigen, dass die Angeklagte in der betreffenden Situation verängstigt gewesen sei. Aus diesem Grund beantragte er insgesamt 50 Tagessätze à 40 Euro.
Die Verteidigung hob in ihrem Abschlussplädoyer hervor, dass in diesem Fall Aussage gegen Aussage stehe. Im Punkt der Personalienabfrage sei die Einlassung nicht widerlegt, der Zeuge spreche zwar von einer Standardmaßnahme, aber der Vorfall stelle ja gerade kein Standard dar. Des Weiteren erläuterte der Verteidiger mit Nachdruck, dass ein „Festhalten“, wie es der Polizeibeamte bei Frau B. angewandt habe, nur bei erheblichen Ordnungswidrigkeiten zulässig sei und da in diesem Fall noch nicht mal Anzeige erstattet wurde, könne von einer erheblichen Ordnungswidrigkeit nicht gesprochen werden. Zu bedauern sei, dass in der Ausbildung der Polizeibeamt_innen wohl nicht enthalten sei, dass bei Ordnungswidrigkeiten schon einfache Gewaltanwendung nicht gestattet sei, dabei sei dies doch besonders bei Präventionsbeamten von Bedeutung. Die Verteidigung plädierte für Freispruch.
Dieser wurde im Urteil bestätigt. Die Richterin erklärte, dass es einfach eine blöde Situation gewesen sei. Der Polizeibeamte J. hätte alles richtig machen wollen, Frau B. sei in Eile gewesen, hätte die Situation nicht gleich verstanden, hinzu sei die Aufregung gekommen. Dennoch wurde durch die Richterin betont, dass es eben genau in solchen Situationen unerlässlich sei, dass die Förmlichkeiten von Polizeibeamt_innen eingehalten werden. Frau B. hätte mehrfach durch den Zeugen J. belehrt werden müssen.