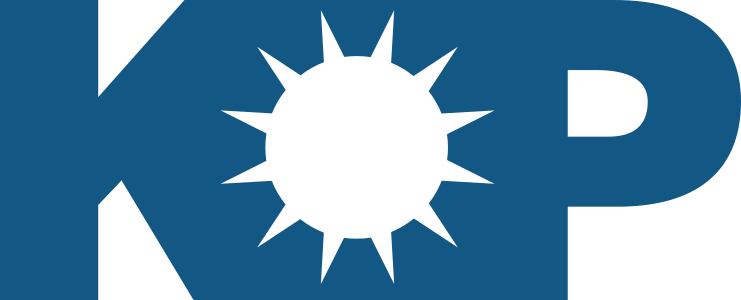ak – Analyse&Kritik | Nr. 602 | 17. Februar 2015 | S. 19
Von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP)
Überall auf der Welt gehen am 15. März Aktivist_innen gegen Polizeibrutalität auf die Straße. Es ist Zeit, den Tag auch nach Deutschland zu holen. Das Datum erinnert an den 15. März 1996, als in der Schweiz zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren Opfer von Polizeigewalt wurden. Daraufhin rief die Schweizer Gruppe »Black Flag« den Tag gemeinsam mit dem kanadischen Kollektiv C.O.B.P. (Collectif Opposé à la Brutalité Policière/Kollektiv gegen Polizeibrutalität) ins Leben. Bis heute demonstrieren an diesem Tag weltweit Menschen in vielen Ländern, darunter Kanada, Mexiko, die USA, Nigeria, Kolumbien, Portugal, Österreich, die Schweiz, Belgien und Spanien.
Die Beispiele Kanada und USA
Das C.O.B.P. formierte sich 1995 nach einer Demonstration gegen die rechtsextreme, fundamentalistisch-christliche Vereinigung »Human Life International« in Montréal. Bei der Demonstration war die Polizei extrem gewaltsam gegen die Aktivist_innen vorgegangen. Einige von ihnen gründeten daraufhin das C.O.B.P., einen Zusammenschluss von Menschen, die häufig von Polizeigewalt betroffen sind, weil sie gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt sind und/oder als »kriminell« stigmatisiert werden: People of Colour, Jugendliche, Wohnungslose, psychisch Kranke, Sexarbeiter_innen, LSBTTIQ. (1) Als Kollektiv klären sie über Polizeibrutalität auf, veranstalten Workshops, verteilen Informationsbroschüren und beraten Opfer von Polizeigewalt. Sie veröffentlichen Fälle und haben zudem eine »Copwatch«-Gruppe, die aktiv polizeiliche Maßnahmen beobachtet und dokumentiert.
Allein in Montréal starben ihnen zufolge seit 1987 125 Menschen durch staatliche Gewalt. »Diese Zahl enthält Menschen die erschossen wurden, durch Pfefferspray oder physische Gewalt starben oder bei Polizeieinsätzen. Dazu zählen auch Selbstmorde, die in Polzeigewahrsam begangen wurden«, erläutert Frank vom C.O.B.P.
Seit 1997 organisieren die Mitglieder des C.O.B.P. jährlich eine Demonstration am 15. März in Montréal. Hier gedenken sie der Toten und machen auf aktuelle Ereignisse aufmerksam. Die Polizei tritt bei diesen Demonstrationen stets sehr brutal auf, setzt Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas ein. Es gibt regelmäßig mehrere Hundert Festnahmen. In den vergangenen zwei Jahren konnte die Demonstration nicht stattfinden, weil die Polizei einen Großteil der Teilnehmer_innen bereits direkt bei der Auftaktkundgebung festnahm.
In den USA wird der Internationale Tag gegen Polizeibrutalität ebenfalls seit 1996 begangen. Hier findet er jedoch am 22. Oktober statt und wird maßgeblich von der »October 22nd Coalition« organisiert. Im letzten Jahr wurde hierbei vor allem der Ermordung des 18-jährigen Michael Brown in Ferguson gedacht. (ak 600) Im Aufruf vom Oktober 2014 klagte die Initiative die rassistische Praxis der lokalen Politik und Polizeibehörden an, die zur gewaltsamen Niederschlagung der Proteste führte und die Menschen dazu drängte, zu ihrem Alltag zurückzukehren. In den Medien fand die Ermordung Michael Brown’s eine relativ hohe Aufmerksamkeit, sie wurde jedoch von vielen Seiten als bedauernswerte Ausnahme betrachtet.
Dagegen weist die »October 22nd Coalition« darauf hin, dass allein zwischen Januar und Oktober 2014 in den USA über 800 Menschen von Strafverfolgungsbehörden getötet wurden – das sind 23 Menschen pro Woche. Neben rassistischer Polizeigewalt nimmt auch die Polizeigewalt gegen Frauen und Trans*-Personen ein immer größeres Ausmaß an. (2)
Polizeibrutalität in Deutschland
In Deutschland fehlt es bislang an einer breiten Basis, die Polizeibrutalität gegenüber den vielen gesellschaftlichen Minderheiten anklagt und bekämpft. Lediglich gegen das System rassistischer Strafverfolgungsbehörden formierte sich in den letzten Jahren Widerstand. So beschäftigt sich die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) seit 2002 mit diesem Problem. Sie hat bis 2014 allein für Berlin über 150 Vorfälle rassistischer Polizeigewalt dokumentiert. (3) Dabei verfügen die Betroffenen selbst oft nicht über die Möglichkeit, sich zu beschweren, oder befürchten weitere Diskriminierung, Deshalb werden viele Fälle nicht dokumentiert, geschweige denn zur Anzeige gebracht. Die Zahl der tatsächlichen Vorfälle dürfte also weitaus höher sein.
Polizeibrutalität in Deutschland reicht von körperlichen, psychischen und sexuellen Misshandlungen bis hin zum Mord. Ihr voraus geht nicht selten die Praxis des Racial Profiling (4), die für viele Betroffene Alltag ist. Die Diskriminierung, Stigmatisierung und Gefährdung beschränkt sich jedoch nicht auf rassistische Kontrollsituationen. Sie geht weit darüber hinaus: weil auf eine Kontrolle nicht selten physische Polizeigewalt und Beleidigungen folgen, weil der Korpsgeist im Polizeiapparat die Täter_innen schützt, weil rassistische Rechtsprechung die Opfer oftmals als Täter_innen abstempelt (5) und weil Medienbilder und rassistische oder für Rassismus offene Gesetze die Praxis legitimieren. Kurz: weil rassistische Polizeipraxis Teil eines institutionellen Rassismus in Deutschland ist. (6)
Und so kann jeder Kontakt mit der Polizei für die Betroffenen tödlich enden, ohne dass dies für die Täter_innen ernsthafte Konsequenzen hätte.
Beispielsweise wird am 14. April 2006 der 23-jährige Domininque Koumadio von einem Polizisten erschossen, nachdem ein Kioskbesitzer die Polizei gerufen hatte: Er fühlt sich bedroht von Koumadio, der mit einem Messer außerhalb seines Ladens steht. Als die Polizeibeamten eintreffen, fordern sie ihn auf, das Messer fallen zu lassen. Koumadio reagiert nicht und wird daraufhin, obwohl er in einigen Metern Entfernung von den bewaffneten Polizisten steht, gezielt erschossen. Zeug_innen sagen später aus, es seien keine weiteren Versuche unternommen worden, ihm das Messer zu entwenden. Das gegen den Todesschützen eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde von der Dortmunder Staatsanwaltschaft eingestellt – es habe sich um Notwehr gehandelt. Alle Versuche zur Wiederaufnahme des Verfahrens scheitern.
Der Tod Dominique Koumadios steht in einer langen Liste von Getöteten. Seit Mitte der 1990er Jahre erinnert man sich wütend an den gewaltsamen Tod so vieler, die durch Polizeibrutalität ihr Leben verloren haben:
Kola Bankole, 30 Jahre, aus Nigeria, wird am 30. August 1994 bei seiner Abschiebung von Polizisten durch Knebelung im Flugzeug in Frankfurt/Main erstickt.
Halim Dener, 16 Jahre, aus Kurdistan, wird am 30. Juni 1994 in Hannover beim Kleben von PKK-Plakaten von einem Polizisten hinterrücks erschossen.
Aamir Ageeb, 32 Jahre, aus dem Sudan, erstickt bei seiner Abschiebung am 28. Mai 1999 im Flugzeug in Frankfurt/Main infolge einer vorsätzlichen Körperverletzung durch die Polizei.
Zdravko Nikolov Dimitrov, 36 Jahre, aus Bulgarien, stirbt in Braunschweig in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 1999 an den Folgen von Schussverletzungen durch SEK-Beamte.
N’deye Mareame Sarr, 26 Jahre, aus dem Senegal, wird am 14. Juli 2001 in Aschaffenburg von einem Polizeibeamten angeschossen und verblutet später im Krankenhaus.
Michael Paul Nwabuisi, 19 Jahre, aus Nigeria, stirbt am 12. Dezember 2001 an den Folgen eines Brechmitteleinsatzes der Hamburger Polizei.
Oury Jalloh, 36 Jahre, aus Sierra Leone, verbrennt am 7. Januar 2005 in einer Zelle des Polizeireviers in Dessau.
Laya-Alama Condé, 37 Jahre, aus Sierra Leone, stirbt am 7. Januar 2005 durch einen Brechmitteleinsatz der Bremer Polizei.
Slieman Hamade, 32 Jahre, aus Deutschland, stirbt am 28. Februar 2010 an den Folgen eines Polizeieinsatzes mittels Pfefferspray in Berlin.
Christy Schwundeck, 39 Jahre, aus Benin, wird am 19. Mai 2011 im Jobcenter in Frankfurt/ Main von einer Polizistin erschossen.
Heraus zum 15. März!
Die Polizeimorde sind nur die Spitze des Eisbergs rassistischer Polizeipraxis. Ihre Aufarbeitung gäbe es nicht, würden nicht Angehörige, Freund_innen und Unterstützer_innen für Aufklärung kämpfen. Solidarisch an ihrer Seite stehen können wir gemeinsam am Internationalen Tag gegen Polizeibrutalität. Ein einzelner Aktionstag verändert noch nicht den rassistischen Normalzustand in Polizei und Gesellschaft, er kann jedoch dazu beitragen, Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken und aktivistische Initiativen international stärker miteinander zu vernetzen. Angesichts einer immer engeren internationalen Zusammenarbeit der Polizei – im Einsatz, in der Ausbildung, im Datenaustausch – bedarf es auch eines Widerstandes über nationale Grenzen hinweg.
Wir rufen euch daher auf, euch am 15. März 2015 gemeinsam mit uns und Aktivist_innen auf der ganzen Welt dem schikanierenden und nicht selten tödlichen System rassistischer Strafverfolgung entgegenzustellen – um der Opfer zu gedenken und unserer Wut Ausdruck zu verleihen: »Join us in this struggle that has no borders and that will continue on, for dignity, true justice and freedom! Together let’s put an end to the police state and its brutality!« (C.O.B.P.)
Die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (KOP) betreibt die Website www.kop-berlin.de.
Anmerkungen:
1) Die Abkürzung LSBTTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und sonst von der Norm abweichende Menschen.
3) www.kop-berlin.de
4) Im polizeilichen Kontext wird damit die bewusste oder unbewusste Erstellung eines Verdächtigenprofils bezeichnet, bei dem Merkmale wie Hautfarbe, Haarfarbe oder religiöse Symbole maßgeblich handlungsleitend werden für polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, Durchsuchungen, Ermittlungen und/oder Überwachung.
5) Biplab Basu und A.v.K: Das Gesamtbild ist rassistisch. Rassismus und Justiz, Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V. (Hg.): Rassismus und Justiz, 2013, Seite 18-21.
6) Sebastian Friedrich und Johanna Mohrfeld, Johanna: „Das ist normal“. Mechanismen des institutionellen Rassismus in polizeilicher Praxis. In: Opferperspektive e.V. (Hg.): Rassistische Diskriminierung und rechte Gewalt. Münster, 2013, Seite 194-203.